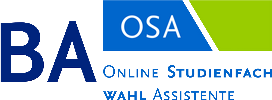Zum Tod von Prof. Dr. Gisela Bock
News vom 13.11.2025
Am 7. November 2025 ist Gisela Bock verstorben, die von 1997-2007 Professorin für Neuere Geschichte Westeuropas am Friedrich-Meinecke-Institut war. Geboren im Jahr 1942, wuchs Gisela Bock in Oberkirch im Schwarzwald auf. Ihre Dissertation, die sich mit dem Dominikanermönch Tommaso Campanella, seinem utopischen Denken und seiner Mitwirkung bei der kalabrischen Revolte gegen die spanische Herrschaft in Süditalien befasst, wurde an der Freien Universität von Wilhelm Berges betreut. 1971 wurde sie ebendort von Hans-Ulrich Wehler als Assistentin eingestellt, und verband ihre wissenschaftliche Arbeit zusehends mit Engagement in der dynamischen politischen Szene Berlins. Sie war unter den Gründerinnen des „Autonomen Frauenzentrums Westberlin“. Im gleichen Jahr erschien ihre deutsche Übersetzung von Mariarosa Dalla Costas und Selma James‘ Buch Die Macht der Frauen und der Umsturz der Gesellschaft, das zu einer Bibel der autonomen Frauenbewegung wurde. 1976 fungierte sie als Mitorganisatorin der ersten Sommeruniversität für Frauen an der FU. Ihr dort gemeinsam mit Barbara Duden gehaltener und ein Jahr später veröffentlichter Vortrag Arbeit aus Liebe – Liebe als Arbeit analysiert weibliche Hausarbeit als unsichtbaren und unbezahlten Teil des kapitalistischen Wirtschaftssystems.
Gisela Bocks Habilitationsschrift Zwangssterilisation im Nationalsozialismus (1986) ist bis heute ein Standardwerk der Forschung. Das Buch untersucht die Geschichte der etwa 400.000 zwischen 1933 und 1945 durchgeführten Sterilisationen des NS-Regimes, zu denen „Asoziale, Minderwertige und hoffnungslos Erbkranke“ (Reichsinnenminister Wilhelm Frick) gezwungen wurden. Die Sterilisation, Gegenstück einer pronatalistischen Politik zur Vermehrung „erbgesunder“ Nachkommen, sollte das gesellschaftliche Projekt der „Volksgemeinschaft“ auf den Weg bringen. Auf den ersten Blick erscheint die NS-Sterilisationspolitik als geschlechterblind, da sie Frauen und Männer gleichermaßen betraf. Da aber die Operation für Frauen deutlich aufwändiger und gefährlicher war und sie um die Möglichkeit brachte, Kinder zur Welt zu bringen, litten sie mehr und anders als die Männer. Unter den geschätzt 5.000 Todesopfern der Sterilisationen waren ca. 90% Frauen – die meisten von Ihnen starben bei dem Versuch, sich gegen die erzwungene Unfruchtbarkeit zu wehren.
Gisela Bocks erste Professur brachte sie an das Europäische Hochschulinstitut in Florenz, wo sie von 1984-1989 lehrte. Von dort führte ihr Weg an die Universität Bielefeld bevor sie 1997 einen Ruf an die Freie Universität erhielt. Ihre internationale Vernetzung und ihr Engagement für vergleichende Perspektiven fanden in der von ihr mitbegründeten International Federation for Research in Women’s History ein Forum.
Den Erkenntnisgewinn einer grenzüberschreitenden Geschlechtergeschichte dokumentiert ihr in viele Sprachen übersetztes Buch Frauen in der europäischen Geschichte (2000). Wegweisend war auch ihre Studie zum Frauenwahlrecht um 1900 (1999), die aus einem breit angelegten internationalen Vergleich eine neue Erklärung für die unterschiedlichen Chronologien in der internationalen Wahlrechtsentwicklung ableitete. Angesichts dessen war es folgerichtig, dass Gisela Bocks gerade anlässlich des einhundertsten Geburtstags des deutschen Frauenwahlrechts im Jahr 2018 im Schloss Bellevue das Bundesverdienstkreuz verliehen wurde.
Gegenwärtige Entwicklungen und Debatten zeigen, dass die von Gisela Bocks Œuvre ausgehenden politischen und wissenschaftlichen Impulse von großer Aktualität sind. Jüngere Initiativen für „Care-Work“ greifen den kritischen Impuls der Kampagne „Lohn für Hausarbeit“ auf, und eine neue Generation liest und diskutiert wieder Mariarosa della Costa. Gegenwärtige Debatten zur vorgeburtlichen Diagnostik und zur genetischen Manipulation entstehenden Lebens brauchen Wissen über vergangene eugenische Praktiken.
Prof. Dr. Oliver Janz
Prof. Dr. Daniel Schönpflug
Die öffentliche Beisetzung findet am 19. Dezember um 12 Uhr auf dem Friedhof Heerstraße, Trakehner Allee 1, 14053 Berlin, statt.