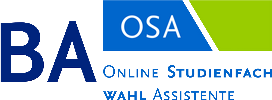Dr. Matthias Sieberkrob

Friedrich-Meinecke-Institut
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Didaktik der Geschichte
Raum A.314
14195 Berlin
Ich bin derzeit bis zum 31. Januar 2026 beurlaubt. Ich biete daher momentan keine Sprechstunden an und betreue vorerst auch keine Haus- und Abschlussarbeiten.
-
10/2022–heute: Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Arbeitsbereich Didaktik der Geschichte, Freie Universität Berlin
-
06/2018–10/2022: Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt „Demos Leben: Demokratiebildung in der Lehrer*innenbildung“, Arbeitsbereich Didaktik der Geschichte, Freie Universität Berlin
-
10/2017–heute: Lehrkraft für besondere Aufgaben, Arbeitsbereich Didaktik der Geschichte, Freie Universität Berlin
-
Winter 2015/2016: Lehrbeauftragter für „DaZ-Förderung im Geschichtsunterricht“, Humboldt-Universität zu Berlin
-
Sommer 2015: Lehrbeauftragter für „DaZ-Förderung im Geschichtsunterricht“, Humboldt-Universität zu Berlin
-
08/2014–07/2017: Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt „Sprachen – Bilden – Chancen: Innovationen für das Berliner Lehramt“, Arbeitsbereich Deutsch als Zweitsprache/Sprachbildung, Freie Universität Berlin
-
Sommer 2014: Lehrbeauftragter für „Diagnostik und Evaluation“, Technische Universität Berlin
-
03/2014–05/2014: Gutachter für den Pädagogischen Austauschdienst im Programm Erasmus+, Leitaktion 2, strategische Partnerschaften im Schulbereich
-
02/2014–03/2014: Lehrkraft/pädagogischer Mitarbeiter in der FAA Bildungsgesellschaft, Berlin
-
07/2013–01/2014: Werkvertrag im Forschungsprojekt „Religion und Biopolitik“ im Exzellenzcluster „Religion und Politik“ an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (Dr. Mirjam Weiberg-Salzmann)
-
02/2013–06/2013: Lehrkraft an der Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo, Leiria, Portugal
-
10/2011–02/2013: Förderlehrkraft an der Max-Brauer-Schule und am Gymnasium Altona, Hamburg
-
10/2011–02/2013: Betreuer in der Kindertagesstätte Vogelnest Altona e. V., Hamburg
-
2023: Dr. phil., Didaktik der Geschichte, Freie Universität Berlin
-
2013: Master of Education, Deutsch und Geschichte, Universität Hamburg
-
2010: Bachelor of Arts, Germanistik und Geschichte, Universität Münster
- 2025: Zertifikat Hochschullehre der Freien Universität Berlin
Wissenschaftliches Arbeiten und Forschungsmethoden
-
2024: Ethnographische Forschungsdesigns
-
2024: Interviews
-
2017: Scientific and Academic Writing in English
-
2017: Qualitative Inhaltsanalyse und Mixed Methods in der empirischen Bildungsforschung
-
2016: Wissenschaftliches Schreiben für Promovierende
Wissenschaftsmanagement
-
2024: Change Management
-
2024: DFG-Projekte planen und beantragen
-
2017: Karriere- und Zukunftsperspektiven in der (Bildungs-)Wissenschaft und im Wissenschaftsmanagement
-
2024–2025: Initiativmittel im Rahmen der Förderlinie START (Freie Universität Berlin) für das Projekt „Historisches Denken und die Zukunft. Soziale Bewegungen zwischen Verlusterfahrung und Gestaltungsmöglichkeiten“
-
2024: DAAD-Kongressreisestipendium
-
2023: Druckkostenzuschuss für die Dissertation, Konferenz für Geschichtsdidaktik (KGD)
-
2022: Finanzierung der Open Access-Gebühren für die Publikation der Dissertation, Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin
-
2015–2016: Stipendiat der Nachwuchsakademie Sprachliche Bildung des Mercator-Instituts für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache, Universität zu Köln
-
2013: Stipendiat des Pädagogischen Austauschdienstes (Comenius)
-
2013: HamburGlobal-Stipendiat
-
2008–2009: Erasmus-Stipendiat, Swansea University, Wales
-
2023–2025: Mitglied im Institutsrat der Dahlem School of Education
-
2023–2025: stellvertretendes Mitglied im Fachbereichsrat des Fachbereichs Geschichts- und Kulturwissenschaften
-
Konferenz für Geschichtsdidaktik – Verband der Geschichtsdidaktikerinnen und Geschichtsdidaktiker Deutschlands e. V. (KGD)
-
Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands (VHD)
-
Lektürekreis Geschichtsdidaktik international
Derzeit biete ich keine Lehre an.
- sprachbildendes historisches Lernen
- historisches Lernen mit Lernaufgaben
- Demokratiebildung und historisches Lernen
- historische agency
- Emotionen und historisches Denken
- empirische Geschichtskulturforschung
- Zukunft als Dimension historischen Denkens
1) Sprachbildung und historisches Lernen – aber wie? (abgeschlossen)
Sprachbildung hat einen emanzipatorischen Charakter. In meiner Dissertation arbeite ich diesen Charakter für das historische Lernen im Sinne des historischen Erzählens mit agency aus. Dabei fokussiere ich Professionalisierung von Geschichtslehrer*innen in diesem Bereich, wobei ich studentische Planungsgespräche für sprachbildenden Geschichtsunterricht mit einer qualitativen Inhaltsanalyse untersuchte. Die Ergebnisse offenbaren grundsätzliche Schwierigkeiten der Student*innen mit dieser Aufgabe. Daher wurde ein Rahmenmodell sprachbildenden Geschichtsunterrichts entwickelt, das auf die Förderung von agency ausgerichtet und sowohl für die Professionalisierung von Geschichtslehrer*innen als auch für die Praxis des Geschichtsunterrichts relevant ist.
Die Dissertation ist 2023 bei Vandenhoeck & Ruprecht erschienen und hier Open Access verfügbar.
2) Sprachen – Bilden – Chancen: Innovationen für das Berliner Lehramt (2014–2017)
Das vom Mercator-Institut für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache an der Universität zu Köln geförderte Projekt war an der Freien Universität Berlin, der Humboldt-Universität zu Berlin und der Technischen Universität Berlin angesiedelt. Ziel war es, die Umsetzung von Sprachbildung und Deutsch als Zweitsprache in der Berliner Lehrer*innenbildung weiterzuentwickeln. Hier war ich wissenschaftlicher Mitarbeiter im Arbeitsbereich Deutsch als Zweitsprache/Sprachbildung an der Freien Universität. In drei Teilprojekten wurden in Kooperation mit Fachdidaktiken sprachbildende Materialien sowie ein phasenübergreifendes Ausbildungskonzept entwickelt. Zudem wurden die jeweiligen Module im Bachelor- und Masterstudiengang evaluiert.
3) Demos Leben: Demokratiebildung in der Lehrer*innenbildung (2018–2024)
Das von der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie finanzierte Projekt wurde von den Fachbereichen Politikdidaktik und politische Bildung (FU Berlin), Didaktik der Geschichte (FU Berlin) und Sachunterricht und seine Didaktik (HU Berlin) getragen. Das Projekt zielte darauf ab, die Demokratiebildung in allen Phasen der Lehrerbildung zu stärken und als festen Bestandteil zu etablieren. Denn der Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schulen umfasst auch, junge Menschen zu eigenständigen und verantwortungsvollen Bürger*innen zu formen. Dies beinhaltet, dass sie befähigt werden, gesellschaftliche Verantwortung zu tragen und sich mit den Grundwerten der Demokratie zu identifizieren. Dieser Auftrag ist in den Schulgesetzen der Länder verankert und wird durch das Recht auf Teilhabe, Demokratie und Inklusion, wie es in den Menschenrechten und speziell in der UN-Kinderrechtskonvention festgelegt ist, gestützt. Angesichts der Herausforderungen durch aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen, wie die Zunahme politischer Radikalisierung und sozialer Ungleichheiten, wird deutlich, dass Demokratie, Menschenrechte, Partizipation und inklusive Teilhabe aktiv gelebt und verteidigt werden müssen. Vor diesem Hintergrund ist eine Lehrer*innenbildung erforderlich, die sich diesen Grundwerten verpflichtet und (angehenden) Lehrer*innen Möglichkeiten aufzeigt, demokratische Bildungsumgebungen zu schaffen.
4) Historisches Denken und die Zukunft. Soziale Bewegungen zwischen Verlusterfahrung und Gestaltungsmöglichkeiten (laufend)
Das Forschungsprojekt widmet sich der Untersuchung des Zukunftsdenkens innerhalb ausgewählter sozialer Bewegungen. Ziel ist es, zu erforschen, welche Rolle das Denken über die Zukunft und aus einer zukünftigen Perspektive in diesen Bewegungen spielt und wie es mit politischem Protest verknüpft ist. Hieraus sollen Implikationen für die Theorie des historischen Denkens abgeleitet werden. Gleichwohl die Zukunft als zeitliche Dimension der geschichtsdidaktischen Theoriebildung eingeschrieben ist und mit dem Prinzip des Gegenwarts- und Zukunftsbezugs auch zum Grundlagenwissen der Disziplin gehört, wurde sie dennoch bislang wenig untersucht. In geschichtstheoretischen Debatten ist die Zukunft seit einigen Jahren jedoch ein zentrales Thema. In diesen wird, beeinflusst durch Kosellecks Arbeiten zum Erfahrungsraum und Erwartungshorizont, die Zukunft als eine temporale Projektionsfläche der jeweiligen Gegenwarten angesehen. Ziel ist, auf den geschichtstheoretischen Arbeiten aufzubauen und zu untersuchen, wie Zukunft innerhalb sozialer Bewegungen konzipiert wird und inwiefern diese Konzeptionen mit der Orientierungsfunktion des Geschichtsbewusstseins verknüpft sind. Ein besonderes Augenmerk liegt darauf, zu analysieren, wie die Präsenz der Zukunft in der Gegenwart nicht nur zur Orientierung, sondern auch zu kollektivem Handeln führt.
5) Verschwinden als Verlust. Narrativierte Emotionen an Orten der sozial- und gesellschaftswissenschaftlichen Bildung (laufend)
Das Projekt basiert auf der Beobachtung, dass aktuelle vielfältige Polykrisen sich in sozialen und individuell unterschiedlich wahrgenommenen Verlustgefühlen widerspiegeln. Aus der Sicht der gesellschafts-, sozial- und kulturwissenschaftlichen Fachdidaktiken interessieren wir uns dafür, wie sich diese Verlusterfahrungen in bildungsrelevanten Bereichen durch Emotionen ausdrücken. Es wird angenommen, dass solche Emotionen durch narrative Formen zum Ausdruck kommen und daher auch durch empirisch-rekonstruktive Methoden untersucht werden können. Hier geht es zur Projektseite.
@Google Scholar @ResearchGate @Orcid
Monografien
-
Sieberkrob, Matthias (2023). Sprachbildung und historisches Lernen – aber wie? Ziele, Professionalisierung, Umsetzung (=Beihefte zur Zeitschrift für Geschichtsdidaktik, Bd. 29). Göttingen: V&R unipress [Open Access].
-
Achour, Sabine/Sieberkrob, Matthias/Pech, Detlef/Zelck, Johanna/Eberhard, Philip (Hrsg.) (2025). Handbuch Demokratiebildung und Fachdidaktik. Band 1: Grundlagen und Querschnittsaufgaben (=Politik und Bildung, Bd. 94). Frankfurt/M.: Wochenschau Verlag [Open Access].
-
Achour, Sabine/Sieberkrob, Matthias/Pech, Detlef/Zelck, Johanna/Eberhard, Philip (Hrsg.) (2025). Handbuch Demokratiebildung und Fachdidaktik. Band 2: Fachperspektiven (=Politik und Bildung, Bd. 96). Frankfurt/M.: Wochenschau Verlag [Open Access].
-
Reusch, Nina/Sieberkrob, Matthias (ersch. 2026). Zeitliches Denken in politischen Protesten der Gegenwart. Eine empirische Untersuchung über das Zukunftsdenken politischer Subjekte. In Martin Nitsche, Julia Thyroff & Monika Waldis (Hrsg.), Geschichtslernen in Zeiten der Krise. Bern: hep.
-
Sieberkrob, Matthias/Wickner, Mareike-Cathrine (ersch. 2026). Sprachbildung im Geschichtsunterricht. In Michele Barricelli & Martin Lücke (Hrsg.), Handbuch Praxis des Geschichtsunterrichts. 3., überarb. Aufl. Frankfurt/M.: Wochenschau Verlag.
-
Achour, Sabine/Sieberkrob, Matthias (2025). Demokratiebildung und Fachdidaktik. Zur Einführung. In Sabine Achour et al. (Hrsg.), Handbuch Demokratiebildung und Fachdidaktik. Band 1: Grundlagen und Querschnittsaufgaben. Frankfurt/M.: Wochenschau Verlag. S. 11–15 [Open Access].
-
Sieberkrob, Matthias (2025). Demokratiebildung und Sprachbildung. Zum Ineinandergreifen zweier Konzepte im Fachunterricht. In Sabine Achour et al. (Hrsg.), Handbuch Demokratiebildung und Fachdidaktik. Band 1: Grundlagen und Querschnittsaufgaben. Frankfurt/M.: Wochenschau Verlag. S. 201–213 [Open Access].
-
Sieberkrob, Matthias/Chmiel, Cornelia (2025). Historisches Lernen über, durch und für Demokratie. Wege der Demokratiebildung im Geschichtsunterricht. In Sabine Achour et al. (Hrsg.), Handbuch Demokratiebildung und Fachdidaktik. Band 2: Fachperspektiven. Frankfurt/M.: Wochenschau Verlag. S. 129–140 [Open Access].
-
Sieberkrob, Matthias/Reusch, Nina (2025). Climate crisis, the Anthropocene and the future: historical thinking in the German climate movement. History Education Research Journal, 22(1), 4 [Open Access].
-
Sieberkrob, Matthias (2023). Konzepte und Ziele der sprachlichen Bildung. Ein Überblick. Diskussion Musikpädagogik, 98. S. 10–17.
-
Chmiel, Cornelia/Sieberkrob, Matthias (2021). Demokratiebildung und historisches Lernen – Mehr als Demokratiegeschichte. Lernen aus der Geschichte-Magazin: Geschichtsdidaktik konkret. Aktuelle Forschungen aus der Geschichtsdidaktik. S. 19–23 [Open Access].
-
Sieberkrob, Matthias (2020). Sprachbildung bedeutet Emanzipation – Wege zum Geschichten Erzählen mit Lernaufgaben. In Thomas Sandkühler & Markus Bernhardt (Hrsg.), Sprache(n) des Geschichtsunterrichts. Sprachliche Vielfalt und Historisches Lernen (=Beihefte zur Zeitschrift für Geschichtsdidaktik, Bd. 21). Göttingen: V&R unipress. S. 253–269.
-
Jordan, Annemarie/Sieberkrob, Matthias (2020). Sprachbildung. In Sabine Achour, Matthias Busch, Christian Meyer-Heidemann & Peter Massing (Hrsg.), Wörterbuch Politikunterricht. Frankfurt/M.: Wochenschau Verlag. S. 221–223.
-
Sieberkrob, Matthias (2020). Wie kann sprachbildender Politikunterricht umgesetzt werden? Prinzipien für die Entwicklung sprachbildender Lernaufgaben. Wochenschau-Sonderausgabe „Sprachbildung im Politikunterricht“, 71. S. 40–43.
-
Sieberkrob, Matthias/Lücke, Martin (2020). Sprachbildende Lernaufgaben im Geschichtsunterricht. In Sebastian Barsch, Bettina Degner, Christoph Kühberger & Martin Lücke (Hrsg.), Handbuch Diversität im Geschichtsunterricht. Inklusive Geschichtsdidaktik. Frankfurt/M.: Wochenschau Verlag. S. 424–439.
-
Sieberkrob, Matthias (2019). „Demokratie!“ – spielend lernen? In Gesicht zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland e. V. (Hrsg.), „Sei frech und wild und wunderbar“ – Ideen, Methoden und Handlungsanleitungen für eine gerechte und aktivierende politische Bildung. Berlin. S. 98–102.
-
Sieberkrob, Matthias (2019). Historisches Erzählen sprachbildend unterstützen im Geschichtsunterricht der Oberstufe. In Kristina Peuschel & Anne Burkard (Hrsg.), Sprachliche Bildung und Deutsch als Zweitsprache in den geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Fächern. Tübingen: Narr Francke Attempto. S. 143–152.
-
Sieberkrob, Matthias (2019). Sprachbildender Geschichtsunterricht. Theoretische Dimensionen und studentische Unterrichtsplanungen. In Christiane Bertram & Andrea Kolpatzik (Hrsg.), Sprachsensibler Geschichtsunterricht. Von der Theorie über die Empirie zur Pragmatik. Frankfurt/M.: Wochenschau Verlag. S. 121–127.
-
Sieberkrob, Matthias (2018). Lernaufgaben für sprachbildenden Geschichtsunterricht. Theoretische Grundlagen und Hinweise für ihre Entwicklung. In Katharina Grannemann, Sven Oleschko & Christian Kuchler (Hrsg.), Sprachbildung im Geschichtsunterricht. Zur Bedeutung der kognitiven Funktion von Sprache. Münster/New York: Waxmann. S. 121–136 [Open Access].
-
Achour, Sabine/Jordan, Annemarie/Sieberkrob, Matthias (2017). Argumentieren in Politik und Gesellschaft. Wie kann der Politikunterricht die politische Kommunikation über sprachbildende Maßnahmen fördern? In Brigitte Jostes, Daniela Caspari & Beate Lütke (Hrsg.), Sprachen – Bilden – Chancen: Sprachbildung in Didaktik und Lehrkräftebildung (=Sprachliche Bildung, Bd. 5). Münster/New York: Waxmann. S. 231–242 [Open Access].
-
Peuschel, Kristina/Sieberkrob, Matthias (2017). Der erweiterte Blick: Studentische Perspektiven auf fachlich-sprachliches Lernen in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern. In Brigitte Jostes, Daniela Caspari & Beate Lütke (Hrsg.), Sprachen – Bilden – Chancen: Sprachbildung in Didaktik und Lehrkräftebildung (=Sprachliche Bildung, Bd. 5). Münster/New York: Waxmann. S. 89–101 [Open Access].
-
Sieberkrob, Matthias/Caspari, Daniela (2017). Entwicklung sprachbildender Aufgaben in den Fächern. In Daniela Caspari (Hrsg.), Sprachbildung in den Fächern: Aufgabe(n) für die Fachdidaktik. Materialien für die Lehrkräftebildung. Berlin. S. 7–17 [Open Access].
-
Sieberkrob, Matthias/Chmiel, Cornelia (2017). Sprachbildung im Politikunterricht. Wie fachliches und sprachliches Lernen umgesetzt werden kann. Wochenschau-Sonderausgabe „Individuelle Förderung“, 68. S. 24–34.
-
Sieberkrob, Matthias/Lücke, Martin (2017). Narrativität und sprachlich bildender Geschichtsunterricht – Wege zum generischen Geschichtslernen. In Brigitte Jostes, Daniela Caspari & Beate Lütke (Hrsg.), Sprachen – Bilden – Chancen: Sprachbildung in Didaktik und Lehrkräftebildung (=Sprachliche Bildung, Bd. 5). Münster/New York: Waxmann. S. 217–229 [Open Access].
-
Achour, Sabine/Sieberkrob, Matthias (2015). Sprachbildung konkret: Brauchen wir eine Impfpflicht? Wochenschau-Sonderausgabe „Heterogenität“, 66. S. 23–37.
-
Sieberkrob, Matthias (2015). Sprachbildung im Politikunterricht – Was gibt es? Was kann man tun? Wochenschau-Sonderausgabe „Heterogenität“, 66. S. 18–19.
-
Sieberkrob, Matthias/Mohr, Sonja/Ittel, Angela (2014). Führungsstil von Schulleitungen und selbstbestimmte Motivation von Lehrerinnen und Lehrern. Zeitschrift für Bildungsverwaltung, 30(1). S. 31–46.
- Sieberkrob, Matthias/Reusch, Nina (2025). Historical thinking, historical agency, and the future: Time and climate activism. HERJ Blog [Link].
- Handro, Saskia/Schönemann, Bernd (Hrsg.) (2022). Sprachsensibler Geschichtsunterricht. Geschichtsdidaktische Forschungsperspektiven und -befunde (=Geschichtskultur und historisches Lernen, Bd. 23). Münster: LIT Verlag. Zeitschrift für Geschichtsdidaktik, 22 (2023). S. 140–142.
-
Sieberkrob, Matthias (7. Juli 2025). Die Lebenswelt in der (Poly-)Krise? Auf dem Weg zu einer Didaktik des Verlusts. Vortrag im Rahmen der „Pädagogischen Werkstattwoche“. Pädagogisches Zentrum Potsdam.
-
Sieberkrob, Matthias (11. Oktober 2024). Historical Thinking in Social Movements: Polycrisis, Future Imagination, and Implications for Historical Learning. Vortrag auf der Tagung „History and Its Discontents: Theory and Practice, Stories from the Classroom“. Annual Conference of the International Society for History Didactics. Providence, Rhode Island.
-
Sieberkrob, Matthias (5. September 2024). Sprachbildender Geschichtsunterricht: (Wie) Gelingt die Professionalisierung? Vortrag auf der Tagung „Future Education: Empowering Learners for Tomorrow“. Universität Graz [wg. Krankheit abgesagt].
-
Sieberkrob, Matthias (3. Mai 2022). Meine, deine, unsere Geschichte(n)? Individuelles und kollektives Erinnern in der diversen Gegenwartsgesellschaft. Moderation des Panels mit Lâle Yildirim, Mehmet Can, Susann Karnapke & Juliana Kolberg in der Veranstaltungsreihe „Geschichte inklusiv: Auf der Suche nach einer demokratischen Geschichtskultur. Theorien – Kategorien – Konzepte – Praxis“. Berliner Landeszentrale für politische Bildung.
-
Sieberkrob, Matthias (27. September 2019). Demokratiebildung und historisches Lernen. Vortrag im Panel „Demokratiebildung. Fachdidaktische Perspektiven“ auf der 7. Berliner Schulleitungstagung. Heinrich-Böll-Stiftung. Berlin.
-
Sieberkrob, Matthias (25. September 2019). Sprachbildende Aufgaben für das Fach Geschichte. Ergebnisse aus dem Projekt Sprachen – Bilden – Chancen. Vortrag im Panel „Fachsprache als Leichte Sprache und als Bildungssprache – Sprache und Geschichte im (scheinbaren) Spannungsverhältnis zwischen Inklusion und Sprachbildung“ auf der Tagung Sprachen(n) des Geschichtsunterrichts – Sprachliche Vielfalt und Historisches Lernen. XXII. Zweijahrestagung der Konferenz für Geschichtsdidaktik (KGD). Essen.
-
Sieberkrob, Matthias (10. September 2019). Academic Language Learning in History Classrooms. A Challenge for Teacher Education. Vortrag auf der Tagung „Migration and History Education der International Society for History Didactics“. Annual Conference of the International Society for History Didactics. Akademie für politische Bildung Tutzing.
-
Sieberkrob, Matthias/Jordan, Annemarie (18. Oktober 2017). Sprachbildung im Geschichts- und Politikunterricht. Entwicklung sprachbildender Lernaufgaben. Workshop auf der Fortbildung „Sprachbildung in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern“. LISUM Berlin-Brandenburg.
-
Sieberkrob, Matthias (5. Mai 2017). Sprachbildung in den Fachdidaktiken. Entwicklungen und Produkte aus dem Projekt „Sprachen – Bilden – Chancen: Innovationen für das Berliner Lehramt“. Workshop auf der Tagung „Sprache im Fach – sprachbildende Materialien für die Lehrkräftebildung“. Universität Potsdam.
-
Sieberkrob, Matthias (7. April 2017). „Sprachbildung“, „Sprachförderung“, „sprachsensibel“. Begriffe in der LehrerInnenbildung. Vortrag im Symposium „Sprachbildung, sprachsensibler Fachunterricht, DaZ-sensibler Fachunterricht, Sprachförderung, DaZ-Förderung... Begriffe im Spannungsfeld zwischen Ausbildungs- und Forschungsfragen“ auf der Tagung „Neue Perspektiven für die Lehrkräftebildung: Ergebnisse aus dem Projekt Sprachen – Bilden – Chancen“. Humboldt-Universität zu Berlin.
-
Sieberkrob, Matthias (6. April 2017). Planung von sprachbildendem Geschichtsunterricht: Einblicke in studentische Lernprozesse im Praxissemester. Poster auf der Tagung „Neue Perspektiven für die Lehrkräftebildung: Ergebnisse aus dem Projekt Sprachen – Bilden – Chancen“. Humboldt-Universität zu Berlin.
-
Sieberkrob, Matthias (22. Februar 2017). Studierende planen sprachbildenden Geschichtsunterricht. Erste Ergebnisse aus dem Dissertationsprojekt. Vortrag auf der Mercator-Nachwuchstagung. Universität zu Köln.
-
Schallenberg, Julia/Sieberkrob, Matthias (6. Dezember 2016). Sprachbildung in der Berliner Lehrkräftebildung. Einblicke in die Entwicklungsarbeit von Sprachen – Bilden – Chancen. Workshop auf der Tagung „Von der Alltagssprache in die Berufssprache. Die Sprachentwicklung und berufliche Handlungskompetenz auf dem Weg von der Willkommensklasse über die Berufsvorbereitung bis zur Berufsbildung“. LISUM Berlin-Brandenburg.
-
Krischer, Barbara/Sieberkrob, Matthias (4. November 2016). Schreiben im Geschichtsunterricht. Workshop auf der Tagung „Chancen für die Sprachbildung – Materialentwicklung für die Lehrkräftebildung“. Freie Universität Berlin.
-
Sieberkrob, Matthias/Lücke, Martin (4. November 2016). Sprachliche Bildung im Geschichtsunterricht. Materialien für die universitäre Lehre. Workshop auf der Tagung „Chancen für die Sprachbildung – Materialentwicklung für die Lehrkräftebildung“. Freie Universität Berlin.
-
Sieberkrob, Matthias/Jordan, Annemarie (28. Oktober 2016). Sprachliche Bildung in der Dialogmoderation. Workshop auf der Vertiefungsakademie von Dialog macht Schule e.V. Berlin.
-
Sieberkrob, Matthias (19. September 2016). Sprachbildender Geschichtsunterricht. Theoretische Dimensionen und studentische Unterrichtsplanungen. Poster auf der Tagung „Sprachsensibler Geschichtsunterricht: Von der geschichtsdidaktischen Theorie über die Empirie zur Unterrichtspraxis“ des Arbeitskreises empirische Geschichtsunterrichtsforschung der Konferenz für Geschichtsdidaktik. Universität Hamburg.
-
Peuschel, Kristina/Sieberkrob, Matthias/Jordan, Annemarie (10. Mai 2016). Sprachbildung – Eine Einführung für Dialogmoderator*innen von Dialog macht Schule. Workshop auf der Einführungsveranstaltung für neue Dialogmoderator*innen. Berlin.
-
Oleschko, Sven/Sieberkrob, Matthias (18. September 2015). Schreib- und Sprachkompetenzen im Geschichtsunterricht. Workshop auf der Tagung „Fokus Sprachbildung: Fächerübergreifende und fächerspezifische Perspektiven in der Lehrkräftebildung“. Universität Potsdam.
-
Sieberkrob, Matthias (21. März 2015). Sprachbildung in der historisch-politischen Bildung. World-Café auf dem Workshop „Mehrsprachigkeit – Abseits des Mainstreams“. Universität Potsdam.
-
Sieberkrob, Matthias in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung Berlin und dem Berliner Sportmuseum (Sommersemester 2022). Veranstaltungsreihe Geschichte inklusiv. Auf der Suche nach einer demokratischen Geschichtskultur.
-
Sieberkrob, Matthias/Springmann, Veronika/Lücke, Martin in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung Berlin (13. April 2021). Tagung Geschichte gegen rechts – Gefahrenfelder und Handlungsräume [Programm].
-
Sieberkrob, Matthias/Lücke, Martin (Sommersemester 2020). Vorlesungsreihe ¡Demokratie! – Geschichte, Gegenwart, Zukunft im Rahmen des Offenen Hörsaals an der Freien Universität Berlin [die Vorlesungsreihe musste aufgrund der SARS-CoV-2-Pandemie abgesagt werden] [Poster].
-
Sieberkrob, Matthias (2023). Videovortrag: Demokratiebildung und Sprachbildung. Sprachlich Handeln in der pluralen Demokratie. In Sabine Achour & Philip Eberhard (Hrsg.), Lernmaterialien zur Demokratiebildung in der Lehrer*innenbildung. Berlin.
-
Caspari, Daniela/Andreas, Torsten/Schallenberg, Julia/Shure, Victoria/Sieberkrob, Matthias (2017). Instrument zur sprachbildenden Analyse von Aufgaben im Fach (isaf). In Daniela Caspari (Hrsg.), Sprachbildung in den Fächern: Aufgabe(n) für die Fachdidaktik. Materialien für die Lehrkräftebildung. Berlin. S. 40–46 [Open Access].
-
Chmiel, Cornelia/Sieberkrob, Matthias (2017). Methodenblatt: Ein politisches Urteil schreiben. In Daniela Caspari (Hrsg.), Sprachbildung in den Fächern: Aufgabe(n) für die Fachdidaktik. Materialien für die Lehrkräftebildung. Berlin (Anhang zu Kap. 2.4) [Open Access].
-
Jostes, Brigitte/Sieberkrob, Matthias/Schallenberg, Julia/Darsow, Annkathrin (2017). Rahmenmodell und bereichs- und phasenspezifische Qualifikationsziele. In Brigitte Jostes (Hrsg.), Phasenübergreifendes Ausbildungskonzept für Sprachbildung/Deutsch als Zweitsprache in der Berliner Lehrkräftebildung. Berlin. S. 33–81 [Open Access].
-
Kraft, Andreas/Meissner, Almuth/Schallenberg, Julia/Shure, Victoria/Sieberkrob, Matthias/Caspari, Daniela (2017). Kommentierte Methodenauswahl zur Sprachbildung. In Daniela Caspari (Hrsg.), Sprachbildung in den Fächern: Aufgabe(n) für die Fachdidaktik. Materialien für die Lehrkräftebildung. Berlin. S. 47–61 [Open Access].
-
Sieberkrob, Matthias (2017). Beispiel für eine sprachbildende Aufgabe im Fach politische Bildung: Brauchen wir eine Impfpflicht? In Daniela Caspari (Hrsg.), Sprachbildung in den Fächern: Aufgabe(n) für die Fachdidaktik. Materialien für die Lehrkräftebildung. Berlin. 23 S. [Open Access].
-
Sieberkrob, Matthias (2017). Methodenblatt: Eine Quelleninterpretation schreiben. In Daniela Caspari (Hrsg.), Sprachbildung in den Fächern: Aufgabe(n) für die Fachdidaktik. Materialien für die Lehrkräftebildung. Berlin (Anhang zu Kap. 2.4) [Open Access].
-
Sieberkrob, Matthias (2017). Methodenblatt: Einen historisch argumentierenden Text schreiben. In Daniela Caspari (Hrsg.), Sprachbildung in den Fächern: Aufgabe(n) für die Fachdidaktik. Materialien für die Lehrkräftebildung. Berlin (Anhang zu Kap. 2.4) [Open Access].
-
Sieberkrob, Matthias/Brunzlow, Sarah-Amina (2017). Beispiel für eine sprachbildende Aufgabe im Fach Geschichte: Der Friedensvertrag von Versailles. In Daniela Caspari (Hrsg.), Sprachbildung in den Fächern: Aufgabe(n) für die Fachdidaktik. Materialien für die Lehrkräftebildung. Berlin. 23 S. [Open Access].
-
Sieberkrob, Matthias (2016). Sprachbildung/DaZ in den Fachdidaktiken der Gesellschaftswissenschaften. In Brigitte Jostes (Koordination), Sprachbildung/Deutsch als Zweitsprache in der Berliner Lehrkräftebildung: Eine Bestandsaufnahme. Berlin. S. 41–44 [Open Access].
-
Sieberkrob, Matthias (2016). Kommentierte Darstellung „Sprachsensibler Fachunterricht: Wortschatzarbeit im Geografieunterricht“. In Brigitte Jostes (Koordination), Sprachbildung/Deutsch als Zweitsprache in der Berliner Lehrkräftebildung: Eine Bestandsaufnahme. Berlin. S. 73–75 [Open Access].
-
Sieberkrob, Matthias (2016). Kommentierte Darstellung „Sprachsensibler Fachunterricht: Wortschatzarbeit im Geschichtsunterricht“. In Brigitte Jostes (Koordination), Sprachbildung/Deutsch als Zweitsprache in der Berliner Lehrkräftebildung: Eine Bestandsaufnahme. Berlin. S. 75–78 [Open Access].